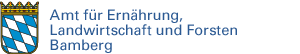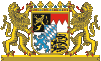Hummeltal/Freising, 7. August 2025
Trotz Borkenkäfer: Oberfrankens Wälder werden vielfältiger
 Zoombild vorhanden
Zoombild vorhanden
Urheber: Benjamin Böhm, Regierung Oberfranken
Der Anteil der Laubbäume im Kronendach ist in den letzten zehn Jahren von 31 % auf 33 % angestiegen. Was sich zunächst nach nicht viel anhört, ist aber in absoluten Zahlen sehr viel: 5.400 Hektar Laubholz kamen in Oberfranken hinzu. Der Anstieg des Laubholzes ging insbesondere zu Lasten der Fichtenfläche. Zugenommen haben hingegen Buchen und Eichen. Damit entwickeln sich die oberfränkischen Wälder weiter in Richtung mehr Naturnähe und Klimatoleranz. „Diese Zahlen belegen die erfolgreichen Bemühungen der oberfränkischen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, ihre oft nadelholzbetonten Wälder in stabilere Mischwälder umzubauen“ unterstrich Regierungspräsident Florian Luderschmid. „Das ist wichtig, denn unsere Wälder sind unverzichtbar für den Trinkwasserschutz, die Erholung und die Biodiversität. Zudem liefern sie den nachwachsenden und klimafreundlichen Rohstoff Holz.“
Oberfranken hat weiterhin die zweithöchsten Nadelholzanteile aller bayerischen Regierungsbezirke. In der zurückliegenden Inventurperiode wuchsen in Oberfranken jährlich rund 3 Millionen Festmeter Holz nach. Dies ist der Grund dafür, dass im gesamten Regierungsbezirk - trotz der dramatischen Wald- und Holzverluste im Frankenwald - die Holzvorräte leicht gestiegen sind. Aber in Zeiten des Klimawandels löst diese Nachricht bei Experten gemischte Gefühle aus: „Der rasante Klimawandel zwingt uns, den laufenden Waldumbau noch zu verstärken. Wir müssen in Oberfranken dringend unsere Baumartenvielfalt weiter erhöhen. Die dramatische Borkenkäferentwicklung im Frankenwald sollte für Oberfranken und darüber hinaus für ganz Bayern eine deutliche Warnung sein.“, warnt LWF-Vizepräsidentin Dr. Ruth Dirsch.
Insbesondere in den Landkreisen Kronach, Hof und Kulmbach hat der Klimawandel deutliche Spuren in der Landschaft hinterlassen. Beginnend mit dem Trockenjahr 2018 sind bis heute mehr als 10.000 Hektar Fichtenwald abgestorben. Dort mussten die Waldbesitzenden erhebliche ökonomische Einbußen hinnehmen, da die hohen Vorräte eingeschlagen wurden als die Holzpreise sehr niedrig waren.
Sehr erfreulich ist hingegen, dass die nächste Waldgeneration oftmals schon in den Startlöchern steht: Auf gut einem Drittel der Waldfläche wachsen unter dem Schutz des Altbestandes bereits junge Bäume. Diese Verjüngung besteht zu 56 % aus Laubbäumen. Allerdings sind auch die Fichtenanteile in der Verjüngung mit 38 % sehr hoch. Um die Mischung vieler Baumarten zu erhalten, ist daher eine gezielte Pflege durch die Waldbesitzer notwendig. Genauso wichtig ist, dass die Jäger mithelfen. „Auch die Jagd spielt eine entscheidende Rolle“, so Dirsch. „Waldangepasste Wildbestände sind die entscheidende Voraussetzung, damit sich die Verjüngung auch gut entwickeln kann.“
Auch in Sachen Biodiversität haben die oberfränkischen Wälder in den letzten 10 Jahren erheblich zugelegt: Die Vorräte an Totholz sind deutlich angestiegen, auch wenn sie mit rund 25 Festmetern pro Hektar noch immer unter dem bayerischen Durchschnitt liegen. Anders als der Name vermuten lässt, ist Totholz alles andere als tot. Es besitzt vielfältige Strukturen, die die Lebensbedürfnisse zahlreicher Arten erfüllen.
Die Bundeswaldinventur liefert im zehnjährigen Turnus fundierte Daten zur Entwicklung und zum Zustand der Wälder in ganz Deutschland. Für die aktuelle Erhebung haben Försterinnen und Förster in Bayern an rund 8 000 Aufnahmepunkten rund 100 000 Bäume vermessen und Informationen zur Waldentwicklung erhoben.
Frau Dr. Haas, Bereichsleiterin Forsten am AELF Bamberg zur 4. Bundeswaldinventur für Oberfranken:
„Es ist ermutigend zu sehen, dass der Umbau unserer Wälder in Richtung klimaresistenter Mischwälder spürbar vorankommt. Das ist ein starkes Zeichen an alle Waldbesitzenden und Forstleute: Eure Arbeit wirkt – und ist von Erfolg geprägt.
Besonders erfreulich ist, dass sich auf vielen Flächen die Natur selbst einbringt – junge Bäume wachsen dort, wo ihre Samen gefallen sind. Diese sogenannte Naturverjüngung hat große Vorteile: Ein Baum, der von Anfang an an seinem Standort wächst, passt sich besser an Boden und Klima an, bildet ein stabiles Wurzelwerk und ist meist gesünder und widerstandsfähiger. Voraussetzung ist, dass bereits klimastabile Baumarten und ihre Samen vorhanden sind.
Trotzdem dürfen wir nicht nur auf die Menge schauen, sondern auch auf die Mischung: Wenn zum Beispiel 60 % der jungen Bäume nur aus zwei Arten bestehen, wird es langfristig kritisch. Denn Vielfalt im Wald ist keine Spielerei – sie ist unsere Lebensversicherung für die Zukunft. Je gemischter ein Wald ist, desto besser kann er mit Sturm, Trockenheit oder Schädlingen umgehen.
Gerade der Landkreis Bamberg und Forchheim hat hier in Oberfranken eine besondere Ausgangslage: Durch die günstigen Böden und Standortverhältnisse finden wir von Natur aus mehr Vielfalt – ein echter Vorteil.
Aber auch hier heißt es: Dranbleiben. Viele Wälder sind überaltert und zu dicht – nicht nur bei den Nadelbäumen. Wir müssen Holzvorräte gezielt reduzieren, alte Bestände durchforsten und Platz für neue, gut durchdachte Verjüngungsflächen schaffen. Gleichzeitig müssen wir auch in die Pflege der jungen Bäume investieren – die Arten, die für die Zukunft besonders wichtig sind, müssen bewusst gefördert werden. Denn klar ist: Einen Wald pflanzt man nicht mit Geld allein. Ohne Pflege, Zeit und Aufmerksamkeit bleibt viel Potenzial ungenutzt – und am Ende wächst statt Wald nur Enttäuschung.
Umso schöner ist es, dass auch im Raum Oberfranken überregionale Fortbildungen für Interessierte geplant sind. Gemeinsam daran zu arbeiten, unsere Wälder fit für die Zukunft zu machen – das ist der richtige Weg.“